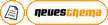4LOM
Administrator

Anmeldungsdatum: 28.02.2005
Beiträge: 3350
Wohnort: North by Northwest
|
 Verfasst am: 25 Nov 2007 22:43 Titel: Verfasst am: 25 Nov 2007 22:43 Titel: |
 |
|
Passend dazu aus dem aktuellen Film-Dienst 24/2007:
| Zitat: | Kein Märchenland
Geschichten aus der deutschen Trickfilm-Provinz
Digitalisierung, interaktive Medien und Rekordergebnisse der japanischen Anime haben die Produzenten weltweit in der Nachfolge von Walt Disney bestärkt, die auf Diversifikation basiert: Spielfilme, Serien, Merchandising, Themenparks etc. – Animation war stets mehr als das altbekannt anthropomorphe Ensemble aus Mäusen, Schweinen und Enten (dies natürlich auch!). Tatsächlich sind Animation und anverwandte Bereiche mehr denn je ein Wirtschaftsfaktor. Animation ist ein fester Bestandteil der globalen Medienszene. Der amerikanische Cartoon-Forscher John A. Lent, der besonders die Entwicklungen auf dem asiatischen Markt beobachtet, fand heraus, dass Japan allein im Jahr 2002 für 4,4 Milliarden Dollar Animationsprodukte in die USA exportierte: von Anime bis Manga, von Spielzeug bis Games. China, als weltweit führender Spielzeugproduzent, mochte da nicht abseits stehen und weiter Lizenzen an amerikanische Unternehmen zahlen. Vielmehr sind die Verantwortlichen bemüht, über die Cheap-Labor-Politik hinaus Ressourcen in Richtung einer eigenständigen Animationspolitik zu bündeln. Allein in diesem Jahr werden im „Reich der Mitte“ annähernd 100.000 Sendeminuten Animation hergestellt (und, wenigstens nach offiziellen Angaben, über 500.000 Animatoren am Computer ausgebildet).
Auch in Europa lässt sich dank forcierter Medienförderung im vergangenen und in diesem Verleihjahr eine wahre Inflation von Animationsspielfilmen auf den Leinwänden registrieren – doch was massiert aus Deutschland kommt, erreicht mittlerweile nicht einmal mehr den einheimischen Markt. 2007 ist das schlechteste Jahr für den deutschen Animationsfilm, der weithin als Sparte für Kleinkinder gilt – so beharrt die Deutsche Filmakademie immer noch auf einer exklusiven Verbindung Kinder- und Animationsfilm. Nicht nur sind unsere inländisch animierten Erzeugnisse im Wettbewerb der Marketingpower der US-Blockbuster wie etwa Pixars „Ratatouille“ unterlegen, ihre Dramaturgie ist auch hoffnungslos veraltet, weil deutsche Kleinkinder als favorisierte Zielgruppe nach Meinung der Förderer und Redakteure in Watte gepackt zu sein haben und vor der bösen Welt geschützt werden müssen.
Ein kleiner König und drei Räuber
„Am Anfang stand eine Frage, die sich viele schon einmal gestellt haben: ‚Was schenke ich meinem Kinde?’... In einer Welt, in der Menschen als Waffen unterwegs sind, in der politische Extremisten sich organisieren, in Deutschland und anderswo Menschen zusammengeschlagen, getötet werden, weil sie eine andere Sprache sprechen, schenkt man doch etwas zum Festhalten.“ So bringt Hans-Werner Honert, Produzent der animierten Kinoversion des aus dem Fernseh-„Sandmännchen“ und dem Kinderkanal bekannten „Kleinen Königs Macius“ (sehr frei nach dem Kinderbuchklassiker von Dr. Janusz Korczak, der in Treblinka umkam) das ehrenwerte pädagogische Anliegen auf den Punkt. Doch die Entmilitarisierung deutscher Kinderstuben entschuldigt nicht miserable künstlerische und dramaturgische Qualität. Stilistisch mehr Mühe gegeben haben sich die Macher von Animation X, dem Trickfilmunternehmen von X Filme Creative Pool, mit „Die drei Räuber“, einer aus Kostengründen in großen Teilen in Manila hergestellten Adaption des Buchs von Tomi Ungerer, das in seiner ursprünglichen Form 1963 erschien. Damals war Co-Produzent Stefan Arndt gerade mal zwei Jahre alt. Seitdem auch diese ebenso nette wie betuliche Geschichte von Geschehnissen im heimeligen Märchenwald an den Kinokassen gefloppt ist, dämmert die Erkenntnis, dass sich offensichtlich mit dem soziokulturellen Umfeld auch der „Geschmack“ der Zielgruppe verändert hat, die lieber „Kim Possible“ oder „Detektiv Conan“ guckt als Erzeugnisse von deutschen Zipfelmützen für deutsche Zipfelmützen. Die Frage ist nicht mehr: Gewalt, ja oder nein? Und: Wie schütze ich mein Kind vor der angriffslustigen Bilderflut aus dem Ausland?, sondern: Wie verarbeite ich ethisch-verantwortlich gesellschaftliche Realitäten und gebe Antwort auf drängende Fragen, die Klapperstorch, Weihnachtsmann und Osterhasen mehr und mehr ausschließen?
Deutsches SimsalaGrimm
Aber versuchen Sie einmal, mit gelegentlich etwas wirklichkeitsfremden, weder zur Analyse noch zum Experiment neigenden deutschen Trickfilmunternehmern und -förderern Realitäten zu diskutieren. Am Stammtisch deutscher Trickfilmer werden Sie, böswillig formuliert, eher zu hören bekommen, wie gut man daran tut, einen Gaul, der einem viele Jahre brav gedient hat, zu reiten, bis er wirklich nicht mehr kann und „reif“ für den Gnadenschuss ist. Man müsse die alten Konzepte allenfalls etwas aufmotzen. Nach diesem Leitsatz gehandelt haben beispielsweise die Hersteller des neuesten Gebrüder-Grimm-Verschnitts „Happily N’Ever After“, der nun auch im Ursprungsland herauskommt, unter dem unendlich blöden Verleihtitel „Es war K’Einmal im Märchenland“. Die Idee: aus einem soliden Volkswagen einen „Ami-Schlitten“ machen, aus einer biederen deutschen 2D-Vorabendserie mit dem Titel „SimsalaGrimm“ über jahrelange Mutation und für einen Etat von mehr als 30 Mio. Euro (aus einem von der Dresdner Bank initiierten und von der BAF Berlin Animation Film kontrollierten Animationsfilmfonds) einen 3D-Computerfilm der amerikanischen Marke „Shrek“. Um diesen Anspruch anzumelden, wurde sogar „Shrek“-Producer John H. Williams an Bord geholt, aber irgendwann haben er und sein deutsch-amerikanischer Kollege Rainer Söhnlein, der nicht müde wurde zu betonen, dass dies, bitteschön, kein deutscher Film sei, sondern ein nach amerikanischen Prinzipien in Deutschland fabrizierter amerikanischer, offensichtlich den Überblick im Märchenwald verloren: Über 90 fabelhafte Wesen, von Aschenputtel und ihrer bösen Stiefmutter bis zu Rumpelstilzchen und den sieben Zwergen, geistern durch die aus den Fugen geratene digitalisierte Fabelwelt, allein: eine echte Hauptfigur ist nicht darunter. Deutsches Mittelmaß, auch wenn es sich amerikanisch geriert, ist offensichtlich prädestiniert für Nebenrollen. Reine Geschmackssache sind auch die dürftigen Gags.
Wie Herbig den deutschen Animationsfilm rettet
Geschmackssache ist auch das neueste Elaborat aus der Weihnachts- und Zuckerbäckerei des Michael „Bully“ Herbig, der sich als Disney- und Animationsfilmfan geoutet hat. Immerhin waren die Helden seiner Kindheit „Wickie und die starken Männer“, und da zur Weihnachtszeit nicht nur Trickfilm, sondern auch „Sissi“ im Fernsehen lief, lag es in Herbigs Hand, „Sissi“ in 3D zu animieren, zumal er die „schönste Frau Österreichs“ in seinem Alter doch nicht mehr live habe darstellen können und wollen (vgl. fd 23/07). Herausgekommen ist „Lissi und der wilde Kaiser“, und ins Kino dürften vornehmlich Leute gehen, die sich auch angesichts der plattesten Banalität noch vergnügt auf die Schenkel klopfen. Statt sich einen oder mehrere versierte Animationsregisseure zu nehmen, die ihr Handwerk halbwegs verstehen, hat Herbig der bunt zusammengewürfelten Schar seiner Animatoren sicherheitshalber das komplette „Universum“ seiner Figuren vorgespielt, von der „Lissi“ bis zum „Schneemenschen“, und sich dabei filmen lassen. Als Referenz mag das ganz hilfreich sein, aber Herbig bestand auf authentischer Umsetzung seines Spiels. Unter dem Gewicht gewaltiger Geschäftserwartungen ist das Projekt dann irgendwo zwischen „Shrek“ und „Charleys Tante“ eingebrochen mit der fadenscheinigen Entschuldigung, dass man es vielleicht doch nicht ganz so gut könne wie Pixar, aber nächstens, verspricht Herbig, wenigstens so ähnlich, wird er sich und Deutschland ganz bestimmt einen „Oscar“ holen. Der Computer ist ein probates Tool, leider gerät es mehr und mehr in die Hände, wenn auch begabter, Dilettanten. Immerhin: Anders als im Fall „Happily N’Ever After“ entsteht der Eindruck, dass bei „Lissi und der wilde Kaiser“ wirklich jeder Cent des Zwölf-Mio.-Euro-Etats in der Produktion steckt. Aber provinziell ist das eine wie das andere.
„Persepolis“
Dass es auch anders geht und dass sich außerhalb des fabelhaft teutonischen Wolkenkuckucksheims mitunter dramatischere Geschichten abspielen, beweisen nach „Das große Rennen von Belleville“ einmal mehr die Franzosen. „Persepolis“ (Budget: 6,5 Mio. Euro) reiht sich ein in das Umfeld zeitgeschichtlicher Animationsfilme wie „Die letzten Glühwürmchen“ (1988) von Isao Takahata aus dem Studio Ghibli, der vom Sterben japanischer Kriegskinder berichtet. „Persepolis“ entstand nach einer als Comic Book verlegten Autobiografie der Iranerin Marjane Satrapi. Es ist die Geschichte eines Mädchens, das zur Zeit der Islamischen Revolution acht Jahre alt ist, Teheran verlässt, dann wieder zurückkehrt, sich aber nicht dem Räderwerk der Revolutionswächter unterwerfen will. Auf die Frage, warum man die Mittel des Animationsfilms gewählt hat, antwortete Marjane Satrapi: „Als Realfilm wäre eine Geschichte über Menschen herausgekommen, die in einem entfernten Land leben und anders aussehen als wir. Im besten Fall eine exotische Geschichte also, im schlechtesten ein ‚Dritte Welt’-Film.“ Die Comics seien deswegen weltweit ein Erfolg gewesen, weil die Zeichnungen abstrakt sind, schwarz und weiß. Auf diese Weise könnten sich Zuschauer überall mit der Figur identifizieren. Es waren eher Gründe stilistischer Natur, hört man ergänzend dazu aus der Produktion, die für einen Animationsfilm sprachen, aber herangegangen sei man an „Persepolis“ wie an einen Realfilm, ebenso wie es die Japaner in ihren Animationsspielfilmen tun. Nicht Zeichentrickfilme waren das Vorbild, sondern expressionistische Filme von Friedrich Wilhelm Murnau bis „The Night of the Hunter“, der einzigen Filmregiearbeit Charles Laughtons.
Interkulturelle Sujets
„Persepolis“ gibt ein Vorbild, das im mutlos gebliebenen deutschen Animationsfilm, trotz einiger beachtlicher Leistungen im Kurzfilm- und Filmschulbereich, nur zögernd oder gar nicht angenommen wird. Nicht Friede, Freude, Eierkuchen, nicht ausschließlich die ehedem erklärten Kinderlieblinge Schlumpf, Mainzel- und Sandmann, sondern auch und gerade ungeschminkte gesellschaftliche Realität ohne Zuckerguss, aber durchaus kindgerecht. Einer der wenigen, der je ein brisantes deutsches Thema in einem (kurzen) Animationsfilm behandelt hat, war ausgerechnet der, der auch die sieben Zwerge und ihr Schneewittchen zu verantworten hat: Walt Disney. 1942/43 schufen die Disney-Leute nach einem Buch von Gregor Ziemer „Education for Death: The Making of a Nazi“, die Verwandlung deutscher Jungen in willfähriges Kanonenfutter. Eine ganze Generation endet in vom Hakenkreuz heraufbeschworenen Stahlgewittern unter den Holzkreuzwäldern endloser Reihen von Kriegsgräbern. Animation vermag viel. In Deutschland braucht es noch immer viel Mut, Geschichte, sofern sie nicht die von „Lissi“ ist, im Trickfilm zu erzählen. Vielleicht helfen ja Co-Produktionen weiter unter der Voraussetzung, dass Stoffe nicht nur der billigen Arbeit wegen im Ausland animiert werden, sondern auch um auf interkultureller Ebene zu erzählen. Die Franzosen machen es uns vor: nicht nur mit „Persepolis“, sondern bereits mit „Kirikou“, einem afrikanischen Jungen, oder mit den „Shaolin Kids“, einer Fernsehserie, die zwischen Shanghai und Paris entstand.
Endlich, lange nach dem Tod des Berliner Produzenten Manfred Durniok, der bereits vor mehr als 20 Jahren Animation in China herstellte, ist auch wieder sinodeutsche Animation angesagt. „Ihr wollt wohl“, scherzte warnend ein deutscher Filmförderer, „dass unsere Cartoon-Figuren alle Schlitzaugen bekommen?“ (Natürlich haben Anime-Charaktere keine Schlitzaugen!) Animation war und ist ein junges Medium, und sie funktioniert nicht gut, wo eine Gesellschaft vergreist. In Deutschland wird mehr über Rente und Altersvorsorge palavert als über Chancen für die kommende Generation. Die Impulse für junge Animation können aus diesem Grund nur von außen kommen. Und was gäbe es da nicht alles zu erzählen! Türkisch-deutsche Geschichten, italodeutsche, deutsch-russische... Ökologische Themen... Geschichten zwischen Krieg und Frieden....
|
|
|